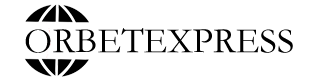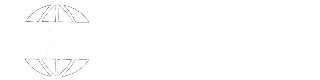1. Öcalans Erklärung könnte die politische Lage in der Türkei – und vielleicht sogar in der Region – stabilisieren
»Keine Atempause, Geschichte wird gemacht«, heißt es in einem halb vergessenen, in diesen Tagen aber wieder topaktuellen Lied aus meiner Jugendzeit. Heute hat der inhaftierte PKK-Anführer Abdullah Öcalan eine möglicherweise historisch bedeutsame Erklärung veröffentlichen lassen. Er hat seine verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zur Beendigung des bewaffneten Kampfes in der Türkei aufgerufen (hier mehr dazu).
Öcalans Forderung wurde von einer prokurdischen Partei in Istanbul verlesen, zuvor hatte eine Delegation der Partei Öcalan auf der Gefängnisinsel İmralı im Marmarameer besucht, wo der Kurdenführer seit 1999 in einem türkischen Gefängnis sitzt. Es sieht so aus, als gebe es einen Deal zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und Öcalan.
»Die Lösung könnte in die Region ausstrahlen und auch Bewegung in die Frage über den Status der Millionen Kurden in Syrien und im Irak bringen«, schreiben meine Kolleginnen Şebnem Arsu und Özlem Topçu sowie mein Kollege Maximilian Popp über die womöglich folgenschwere Wendung in der türkischen Politik.
Es gebe Grund für Optimismus, so die Kollegen: »Entgegen der Entwicklung in der Region, mit dem Krieg in Gaza, dem schwelenden Konflikt im Südlibanon zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz, einem unberechenbaren Regime in Iran, das nicht lassen will von seinem Atomprogramm, und schließlich mit einem aufgewühlten Syrien nach dem Sturz von Diktator Baschar al-Assad, könnte sich die politische Lage in der Türkei stabilisieren.« Meine Kollegin Şebnem Arsu fasst die heutigen Ereignisse in der Türkei so zusammen: »Öcalans Aufruf, nach mehr als 40 Jahren Kampf die Waffen niederzulegen, wird einen langen Annäherungsprozess einleiten. Der lässt darauf hoffen, dass auch die demokratischen Rechte der fast 15 Millionen Kurden im Land gestärkt werden – auch deshalb waren heute in vielen Städten im überwiegend kurdischen Südosten auf der Straße jubelnde Menschen zu sehen.«
Lesen Sie hier mehr: Schreiben Erdoğan und Öcalan heute Geschichte?
2. Im Fall einer Verschärfung des politischen Klimas erwägen zahlreiche US-Bürger offenbar eine Emigration
Nicht nur vielen Europäern, sondern auch einer Menge US-Bürgern wird beim Blick auf das Gebaren der aktuellen Regierung in Washington offenbar mulmig zumute. Sie stellen sich wohl die Frage, die in einem klassischen Song der Band The Clash so formuliert wird: Should I Stay or Should I Go? Zumindest behauptet das der Leiter einer auf die Vermittlung von Staatsbürgerschaften und Aufenthaltsbewilligungen spezialisierten Londoner Kanzlei, den mein Kollege Henning Jauernig interviewt hat: »Viele Amerikaner sehen einen zweiten Pass oder einen Aufenthaltstitel als eine Art Versicherung«, erfährt man in dem Interview. »Sie bereiten sich damit darauf vor, das Land einfacher verlassen zu können, sollten sich die USA zu einer Autokratie entwickeln.« (Lesen Sie hier mehr .)
Offenbar ist bei vielen US-Amerikanern die Karibik beliebt. Wer für Antigua in der Karibik eine Staatsbürgerschaft erwerben wolle, bekomme sie für rund 250.000 Euro, hat mein Kollege erfahren. Schon im Vorfeld der Wahl hätten viele Amerikaner überlegt, das Land zu verlassen, wenn die Gegenseite gewinnt. Das sei ein Ausdruck der zunehmenden Polarisierung im Land. Angeblich zählen Hunderttausende Menschen aus der Mittelschicht zu den Kunden der Londoner Kanzlei.
Vielen US-Bürgerinnen und -Bürgern, die sich eine zweite Staatsbürgerschaft besorgen, geht es aber vorerst nicht ums Emigrieren, sondern um die Sicherheit beim Herumreisen im Rest der Welt. »Der US-Pass ist nicht besonders attraktiv, was das Reisen angeht«, hat der Chef der Londoner Vermittlungskanzlei meinem Kollegen Henning berichtet. »Wegen des großen Einflusses der USA sind Amerikaner nicht gerade beliebt im Ausland. Terroristen nehmen sie gern ins Visier. Ein zweiter Pass kann Leben retten.«
Lesen Sie hier das ganze Interview: »Viele US-Amerikaner wollen jetzt eine weitere Staatsbürgerschaft«
3. So komplexe Charakterköpfe wie Gene Hackman vermisst man im Kino von heute
Er sei »no sentimental guy«, ein Mann ohne übertriebene Feinfühligkeit, hat der Schauspieler Gene Hackman mal in einem Interview gesagt. Für mich war er viele Jahre lang ein Lieblingsschauspieler. Obwohl er in vielen seiner Filme zur Gewalt neigende Schurken gespielt hat, schien er mir ein Künstler mit Herz, Verstand, Bodenständigkeit und vorbildlicher Haltung zu sein. Nun ist Hackman im Alter von 95 Jahren gestorben. Auch wenn er schon länger nicht mehr vor der Kamera stand, hinterlässt sein Tod doch eine Leerstelle in der Filmwelt: Typen wie Hackman sucht man im Gegenwartskino wohl vergeblich.
Hackman, der offenbar gemeinsam mit seiner Ehefrau Betsy Arakawa, die 63 Jahre alt wurde, im Haus des Paars im US-Bundesstaat New Mexico starb, war als Sohn eines Druckers in einer Kleinstadt in Illinois aufgewachsen. Nach einer Zeit beim Militär besuchte er eine Schauspielschule, seinen Durchbruch hatte er 1967 in »Bonnie und Clyde«. Den tollsten Auftritt seines Lebens legte er 1971 als Hauptdarsteller des grandiosen Thrillers »French Connection« hin, der auf Deutsch unter dem Titel »Brennpunkt Brooklyn« lief.
»Hackman hat oft Figuren gespielt, die tragisch verstrickt sind, ohne es zu bemerken«, schreibt mein Kollege Oliver Kaever in seinem Nachruf auf den Hollywoodstar. (Lesen Sie hier mehr .) Viele dieser Männer wirkten vordergründig so, als könnten sie vor Kraft kaum laufen; Typen mit lautem Organ und voller Wut, deren Verhalten man heute als toxisch bezeichnet würde. »Man muss schon genauer hinsehen, um zu begreifen, dass sein Spiel in Wahrheit eine Demontage typisch männlich konnotierter Verhaltensweisen ist«, so Oliver. Gerade in »French Connection«, in der Rolle des Drogenfahnder-Detectives »Popeye« Doyle, gelinge es Hackman meisterhaft, »die Tragik seiner Figur subtil zum Vorschein zu bringen – niemals wird Doyle der Wut, die ihn von innen verzehrt, entkommen können«.
Lesen Sie hier den vollständigen Nachruf: Der Selbstbestimmte
Was heute sonst noch wichtig ist
Forscher empfehlen Deutschland, steigende Militärausgaben durch Kredite zu finanzieren: Nato-Chef Mark Rutte hat Deutschland bereits aufgefordert, mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Eine Studie untersucht, wie diese Ausgaben finanziert werden können – und warnt vor alten Fehlern.
ÖVP, SPÖ und Neos einigen sich auf Koalition in Österreich: Österreich bekommt nun doch eine Regierung ohne Beteiligung der rechtspopulistischen FPÖ. Nach wochenlangem Hin und Her haben sich Konservative, Sozialdemokraten und liberale Neos auf ein Bündnis verständigt.
Frankreich will Rohstoffe der Ukraine nutzen: Neben den USA möchte auch Frankreich auf Bodenschätze in der Ukraine zugreifen. Laut Verteidigungsminister Sébastien Lecornu laufen entsprechende Verhandlungen seit Oktober 2024.
Experten warnen vor mehr Masernausbrüchen in den USA: In Texas breitet sich derzeit die einst ausgerottete Kinderkrankheit Masern aus, ein ungeimpftes Kind ist bereits gestorben. Ärzte warnen vor einer schweren Gesundheitskrise.
Was wir heute bei SPIEGEL+ empfehlen
»Es kitzelt so stark, dass du schwer loslassen kannst«: Thomas Müller spielt seit einem Vierteljahrhundert für den FC Bayern. Im Sommer endet sein Vertrag. Hier spricht er über Heimatgefühle, die Trainer seiner Karriere und das, was vielleicht kommt .
Was heute weniger wichtig ist
Einsame Pionierin: Hollywoodstar Halle Berry, 58 Jahre alt und seit 2002 die erste und einzige schwarze Schauspielerin, die je den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen hat, hofft auf die Auszeichnung einer schwarzen Kollegin in diesem Jahr. Bei der diesjährigen Oscarverleihung ist die Britin Cynthia Erivo für deren Hauptrolle im Film »Wicked« nominiert. In einem Podcast sagte Berry: »Ich hoffe, dass dieses Jahr jemand neben mir steht. Denn ich habe es satt, diesen Platz allein zu besetzen.«
Mini-Hohl
Hier finden Sie den ganzen Hohl.
Cartoon des Tages
Und heute Abend?
Könnten Sie sich im Kino den spannenden, klugen und auch schwer ans Herz gehenden Film »Heldin« mit Leonie Benesch in der Hauptrolle ansehen.
Ich habe Benesch, die im Film eine überforderte, einfühlsame und irgendwann ausflippende Pflegekraft in einem großen Krankenhaus spielt, zum Interview für eine Geschichte über ihre Karriere und ihre umwerfend tolle Darstellung der Pflegerin Floria getroffen. Benesch sagt: »Was mich in dem Film am meisten packt, ist das Wissen: Floria wird am nächsten Tag wieder da sein, so beschissen die Umstände auch sein mögen.« (Lesen Sie hier die ganze Rezension .)
Einen schönen Abend. Herzlich
Ihr Wolfgang Höbel, Autor im Kulturressort
Präsident Erdoğan im AKP-Fraktionssaal: Ein potenziell historischer Tag
Foto: Turkish President Press Office / EPAEin deutscher und ein amerikanischer Reisepass: »Ein zweiter Pass kann Leben retten«
Foto: 7aktuell / IMAGOSchauspieler Gene Hackman: Alles andere als ein Hollywoodhaudegen
Foto: Vera Anderson / WireImageThomas Müller
Foto:Amelie Niederbuchner / DER SPIEGEL
Aus dem E-Paper der »Oldenburgischen Volkszeitung«
Entdecken Sie hier noch mehr Cartoons.
Thomas Plaßmann
Darstellerin Benesch im Film »Heldin«: »Ich habe keine Lust, für meinen Beruf zu leiden«
Foto: Salvatore Vinci / Tobis Film