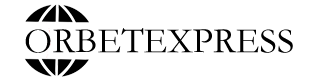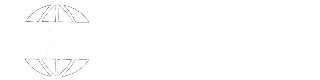Die Veranstaltung in der Weimarhalle begann um kurz nach zehn Uhr morgens. Bewegende Musik erklang, Bilder der befreiten KZ-Häftlinge erschienen an der Wand. Foto für Foto so viel Leid, das unmittelbar und sehr tief berührt. Plötzlich mutete alles andere, mutete sogar die Aufregung um diese Gedenkveranstaltung unbedeutend an.
Aber das ist es nicht, trotz oder wegen der Wucht dieser Bilder.
Am 11. April 1945 wurden die Gefangenen der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora befreit. Des anstehenden 80. Jahrestags wurde bereits heute mit zwei Veranstaltungen gedacht, am Vormittag mit einer Gedenkfeier, am Nachmittag mit einer Kranzniederlegung sowie weiteren Ansprachen auf dem Appellplatz von Buchenwald. Man gedachte so der Befreiung von 1945, die der Menschheit wieder Hoffnung gab, auch wenn sie den Schmerz über die vielen Ermordeten nicht lindern konnte. Die deutsche Unmenschlichkeit, die sich eben auch in den Bildern in der Weimarhalle zeigte, hatte die Welt für immer verändert.
Wäre das Gedenken heute aber beeinträchtigt gewesen, wenn der israelisch-deutsche Philosoph Omri Boehm eine Rede gehalten hätte? So war es ursprünglich geplant gewesen, so wurde es dann verworfen, weil die israelische Botschaft die Einladung Boehms für »empörend« hielt, für eine »eklatante Beleidigung des Gedenkens an die Opfer«. Öffentlich sagte man das allerdings erst, nachdem der SPIEGEL über die Vorgänge berichtet hatte.
Leise Misstöne
Jens-Christian Wagner, der Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, hatte Boehm eingeladen und diese Einladung dann zurückgezogen. Auch er wollte die Vorgänge aus der Öffentlichkeit heraushalten. Gegenüber dem SPIEGEL verwies er auf die anreisenden Überlebenden, er wolle seine Ehrengäste vor einem Konflikt schützen, mit dem sie nichts zu tun hätten.
»Es ist ihr Tag«, sagte er auch in seiner heutigen Begrüßungsrede, aber war es das wirklich? Eine leise Missstimmung deutete sich an, die dem Gedenken nicht guttat. Da schwelte etwas.
Was genau?
Der Jahrestag möge dazu beitragen, so sagte Wagner gegen Ende seiner vormittäglichen Ansprache, dass das Bewusstsein »für die Achtung der universellen Menschenrechte wieder zunimmt«. Der Begriff des Universellen aber wird von vielen mit Boehm verbunden. Und so reagierte Wagner – etwas trotzig – auf die, die ihm ja nicht die Einladung, sondern vielmehr die Ausladung des von ihm selbst hochgeschätzten Philosophen für diesen Tag vorwarfen. So war Boehm auf gewisse Weise im Raum, mit ihm allerdings auch der Streit der vergangenen Tage.
Präsent wirkte Boehm auch, als Thüringens Regierungschef Mario Voigt am Rednerpult stand. Der CDU-Mann Voigt erwähnte den 7. Oktober, er sprach von der blutigen Gegenwart des Judenhasses und nannte es ein Versagen, wenn Intellektuelle die Geschichte relativierten, um Entlastung für die Gegenwart zu schaffen. Meinte auch er Boehm und wollte er das als scharfe Kritik an ihm verstanden wissen? Schließlich lauten die Vorwürfe der israelischen Regierung gegen den Denker auffallend ähnlich.
Man muss dazu wissen: Auch Mitglieder von Boehms Familie wurden von den Nazis verfolgt. Er selbst, der seit vielen Jahren in New York lehrt, hat das Recht, seine eigenen Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Doch der israelischen Regierung reicht seine (anhaltende) Forderung eines binationalen Israels als Beleg für eine angeblich staatsgefährdende Einstellung. Das alles wurde so nicht formuliert in Weimar, schwang aber mit. Es war dann der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, der den Namen Omri Boehm wenigstens aussprach. Es war nur eine Randbemerkung, aber immerhin.
Wulff forderte, die Unveräußerlichkeit der Menschenrechte zu verteidigen und fügte hinzu, deshalb wolle er auch etwas zu Omri Boehm sagen. »Ich sehe ihn als Anwalt universeller Menschenwürde mit dem Ziel der Gerechtigkeit, Verständigung und Versöhnung«. Aber er, Wulff, dürfe hier auch sagen, »Omri Boehm und ich verstehen die Empfindsamkeit angesichts des unendlichen Leids der noch immer in den Händen der Terrororganisation Hamas befindlichen israelischen Geiseln«.
So warb er etwas umständlich um Verständnis für den Verständiger, dessen Idealismus und Pazifismus manche – und nicht nur die israelische Regierung – als unzulässigen Angriff auf die Existenz Israels als Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden bewerten.
Schwer zu sagen, ob man in diesem Moment weit weg war von Buchenwald oder ganz nah dran. Die auch und gerade aus dieser Vergangenheit geborene Welt ist eine schwierige. Man muss sich aber mit ihr auseinandersetzen, in aller Offenheit reden.
Boehm wurde das heute also versagt. Wulff wiederum nutzte seine Rede ansonsten dazu, immer wieder eindringlich vor der AfD zu warnen, auch vor dem Glauben einiger Demokraten, diese Partei durch Einbindung entzaubern zu können. Allein der Versuch der AfD, die Vergangenheit im Zuge einer erinnerungspolitischen Wende schönreden zu wollen, sollte tatsächlich alle Alarmglocken läuten lassen.
Was sollte als Genozid bezeichnet werden?
80 Jahre nach der Befreiung von Buchenwald zeigte sich an diesem Sonntag vor allem, dass das Gedenken schwerer denn je ist, obwohl es nie wichtiger für die Zukunft war.
Das bestätigte sich wenige Stunden später auf dem einstigen Appellplatz von Buchenwald. Zu den Rednern dieser zweiten Zeremonie gehörte der 92 Jahre alte Naftali Fürst, der Buchenwald fast nicht überlebt hätte. Er richtete sich nun an die Nachgeborenen, die Zeugen der Zeugen, denen viel Verantwortung bevorstehe.
Nur noch bis Mai 2025 steht Fürst dem Internationalen Komitee Buchenwald-Dora und Kommandos vor, dem IKBD. Diese Organisation, die sich dem Frieden verschrieben hat, hatte Jugendliche aus ganz Europa gebeten, sich der grundlegenden Frage zu widmen, welche Lehren aus dem Nationalsozialismus zu ziehen seien. Eine der jungen Frauen beklagte bei der Veranstaltung heute auch die Toten von Gaza, den dortigen Genozid. Gedenkstättenleiter Wagner verwahrte sich, kaum waren ihre Worte verhallt, gegen diese Begrifflichkeit. Man dürfe mit den Menschen in Gaza trauern, aber es gehöre sich seiner Meinung nach nicht, von einem Genozid zu sprechen.
Und dann wird die Rede doch veröffentlicht
Man ist sich einig über den zentralen Wert der Menschlichkeit, zerstreitet sich aber über Begriffe, die das Unmenschliche betreffen. Dahinter steckt natürlich auch der Kampf um die Singularität des Holocaust: Was darf man nach diesem einen Genozid noch als solchen bezeichnen?
Während in Buchenwald gesprochen und gerungen wurde, veröffentlichte die »Süddeutsche Zeitung« jene Rede, die Boehm morgens nicht gehalten hatte. Und dieses Vorgehen passte zu diesem Tag, an dem der abwesende Philosoph ohnehin dauernd anwesend war.
Die Losung »Nie wieder« sei nur in ihrer universellen Form gültig, schreibt er. »Zumal eine Welt, in der nur den Juden der Ausrottungskrieg, den sie erfahren mussten, künftig erspart bleiben soll, eine Welt ist, in der auch ihnen weitere Ausrottungskriege nicht erspart bleiben werden.«
Hätte er das auch in Weimar heute sagen können? Sicher hätte das eine heftige Debatte ausgelöst. Doch genau das wurde heute auch in den Reden gefordert: nicht zu schweigen.
Das Reden ist wichtig und ebenso die weitere Erforschung der Geschichte, diese Erkenntnis kam heute sogar zu kurz. Noch ist das ganze Ausmaß der NS-Verbrechen nicht bekannt, und das macht es denen leicht, die es ohnehin nicht so genau wissen wollen.
Bildprojektionen zu Beginn der Gedenkfeier in der Weimarhalle
Foto: Bodo Schackow / picture alliance / dpaDer Überlebende Alojzy Maciak: War es der Tag der Opfer?
Foto: Jacob Schröter / IMAGOEx-Bundespräsident Wulff: Verständnis für den Verständiger
Foto: Bodo Schackow / dpa