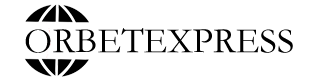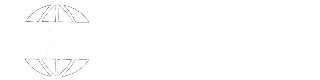»Clean, baby, clean« statt »Drill, baby, drill« – so könnte man vielleicht die Botschaft der EU gegenüber Trumps Rollback in der US-amerikanischen Energiepolitik beschreiben. Während der neue US-Präsident seit seiner Amtseinführung systematisch die Umwelt- und Klimapolitik sowie die grüne Transformation in seinem Land zurückdreht , hat die EU-Kommission in dieser Woche ihren Kurs bei der Energiewende trotz einiger Rückschritte, etwa beim Lieferkettengesetz, noch einmal geschärft.
Gegen zunehmende Widerstände auch von rechten Kräften in der Union selbst hält die Kommission damit am vor fünf Jahren ausgerufenen Green Deal fest, der die Union bis 2050 klimaneutral machen soll. Dafür stellte sie diese Woche ein neues Maßnahmenpaket, den Clean Industrial Deal (»Saubere-Industrie-Deal«), in Brüssel vor. Energieintensive Industrien sollen bei der grünen Wende unterstützt und klimafreundliche Technologien gefördert werden.
Einen kräftigen Schub kann die europäische Wirtschaft auf dem Weg ins klimaneutrale Zeitalter gut gebrauchen. Viele der 27 Länder ächzen noch unter den Folgen der Coronapandemie und der Energiekrise. Die Gefahr, dass etwa Populisten die Schuld für die derzeitige schwierige Lage in vielen Ländern bei Migration und Klimaschutz suchen, ist hoch. Aber nicht Windräder oder Solarparks sind ursächlich für hohe Energiepreise in Deutschland, sondern das importierte Erdgas – und die jahrelange Abhängigkeit von vermeintlich günstigem Erdgas aus Russland. (Ebenso sind Migranten nicht daran schuld, dass es seit der Coronapandemie mehr Armut und Lohnungleichheit in der EU gibt.)
Die EU-Kommission will die Energiepreise senken, auch indem sie Importe von fossilen Brennstoffen meidet. Das Signal: Wer unabhängig wird, spart Geld. Bereits im laufenden Jahr könnten das bis zu 45 Milliarden Euro sein, bis 2040 schätzt die Kommission die Summe auf jährlich bis zu 260 Milliarden Euro.
Der Plan soll die heimische grüne Industrie fördern. Klimafreundliche Technologien »made in Europe« sollen bevorzugt werden, etwa bei der öffentlichen Beschaffung. Mit den Vorschlägen hofft die Kommission darauf, kurzfristig Investoren anzulocken. Sie will zudem eine Bank für industrielle Dekarbonisierung einrichten und mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Das Geld soll unter anderem aus dem EU-Emissionshandel, den Mitgliedstaaten und anderen EU-Fonds kommen.
Der Kampf um die Gelder ist bereits ausgebrochen
Doch welche Art von grüner Technologie unterstützt werden soll, ist hochumstritten. Die EU muss sich entscheiden, ob sie etwa teure E-Fuels für Verbrennerautos oder grünen Wasserstoff für Heizungen fördert. Oder eine starke europäische Elektroauto- und Wärmepumpenindustrie aufbaut und synthetische Brennstoffe ausschließlich für Bereiche einsetzt, wo es keine Alternativen gibt.
Walburga Hemetsberger, CEO von SolarPower Europe, warnte etwa bereits gegenüber »Table.Media«, »die Dekarbonisierungsbank läuft Gefahr, die Elektrifizierung gegen gasabhängige Lösungen auszuspielen«. Und auch Julia Metz, Direktorin des Thinktanks Agora Industrie, sieht bereits einen Konkurrenzkampf um die Verteilung der Gelder.
Die Botschaft der Kommission ist jedoch grundsätzlich richtig: Die EU muss nicht nur grüner, sondern auch unabhängiger werden. Derzeit kommen fast alle Solarpanels aus China , die europäische Autoindustrie ist extrem unter Druck, weil ausländische Firmen viel weiter bei der E-Mobilität sind.
Die EU muss ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und darf sich nicht länger auf vermeintlich günstige Importe aus dem Ausland verlassen – egal, ob es sich um Solarzellen oder Erdgas handelt. Eine solche Abhängigkeit macht politisch erpressbar, gerade in Zeiten wie diesen, in denen Diktatoren und Rechtspopulisten die internationale Ordnung einreißen.
Wenn Sie mögen, informieren wir Sie einmal in der Woche über das Wichtigste zur Klimakrise – Storys, Forschungsergebnisse und die neuesten Entwicklungen zum größten Thema unserer Zeit. Zum Newsletter-Abo kommen Sie hier.
Die Themen der Woche
Friedrich Merz und die Klimapolitik: Einmal »Rambozambo«, bitte
Die Union sprach im Wahlkampf vor allem dann über die Energiewende, wenn sich damit die Grünen attackieren ließen. Friedrich Merz müsste als neuer Bundeskanzler das Poltern nun schnell in konstruktivere Bahnen lenken.Sorge um Transformation: Unternehmer geben Energiepolitik der AfD eine glatte Fünf
Die AfD will Windräder abreißen und wieder Gas aus Russland importieren. Das sieht einer Studie zufolge nicht einmal die Industrie als »erbauliches Zukunftsszenario«. Auch mit anderen Plänen fällt die Partei bei Firmen durch.Grün wider Willen: Klimapolitik ist abgewählt – wirklich?
Friedrich Merz möchte klimapolitische Gesetze der Ampel kippen. Dafür gibt es aber kaum Spielraum. Dem Bundeskanzler in spe wird nichts anderes übrig bleiben, als grüne Politik zu machen.Untersuchung in Brandenburg: Nach Waldbränden droht ein Teufelskreis
Feuerschäden können Gebiete noch empfindlicher machen, sagen Forschende. Eine neue Studie liefert aber auch ermutigende Erkenntnisse darüber, wie sich Waldflächen erholen. Zwei Dinge sollten Menschen demnach vermeiden.Kälteeinbruch in Europa: Warum der Golfstrom womöglich doch nicht kollabiert
Die Nordatlantikströmung sorgt in Europa für gemäßigtes Klima. Manche Experten befürchten, sie könnte in diesem Jahrhundert komplett ausfallen. Nun widersprechen Kollegen, Risiken sehen sie dennoch.Umbenennung von Letzter Generation: »Unsere Demokratie ist nicht der Weisheit letzter Schluss«
Die Letzte Generation gibt sich einen neuen Namen und will mit »Parlamenten der Menschen« selbst Politik machen. Und wenn Bund, Länder und Städte nicht reagieren? Aktivist Raphael Thelen sagt: Dann soll ziviler Ungehorsam folgen.Ankündigung von Konzernchef Auchincloss: Ölmulti BP setzt künftig wieder auf fossile Energie
180-Grad-Wende bei BP: Der Konzern will Investitionen in erneuerbare Energien drastisch zurückfahren und setzt, um Aktionäre zu besänftigen, wieder massiv auf Öl und Gas.Fortsetzung der Weltbiodiversitätskonferenz: Warum viele Länder das Artensterben hinnehmen
Eine abgebrochene Uno-Konferenz und kraftlose Pläne: Der Artenschutz kommt weltweit kaum voran. Nun suchen in Rom rund 200 Länder nach einer Lösung. Doch einem wirksamen Naturschutz stehen mächtige Interessen entgegen.
Bleiben Sie zuversichtlich!
Ihre Susanne Götze
Redakteurin Wissenschaft
EU-Kommission feiert den Clean Industrial Deal: Höchste Zeit, endlich unabhängiger zu werden
Foto: Olivier Hoslet / EPATrump-Fans in den USA: Hoffen auf ein fossiles Comeback
Foto: Alex Brandon / APÖlfeld in Texas: »Drill, baby, drill«
Foto: Nick Oxford / REUTERS