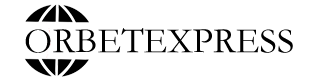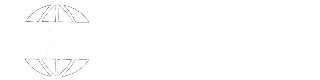CDU-Chef Friedrich Merz hat im Wahlkampf klimapolitisches Erwartungsmanagement betrieben: Er werde Schluss machen mit der »ideologiegetriebenen Politik«, Windkraft sei eine »Übergangstechnologie«, das Heizungsgesetz gehöre abgeschafft und wenn es irgendwie gehe, wolle man zurück zur Atomkraft.
Misst man den diese Woche vorgestellten Koalitionsvertrag an diesen Aussagen, waren die Verhandlungen von CDU/CSU und SPD ein Erfolg für den Klimaschutz. Denn nichts von dem, was Merz an Rückschritten beim Thema angedroht hat, kann er wirklich durchsetzen. Die bereits von den Vorgängerregierungen und der EU-Kommission beschlossenen Klimaziele und Maßnahmen sorgen dafür, dass er den Status quo nicht revidieren kann. Und das ist gut so.
Die neue Koalition bekennt sich dazu, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll. Das kann man als selbstverständlich abtun. Aber in einer Welt, in der in anderen Staaten alles an Klimapolitik zurückgedreht wird, ist das eine wichtige Zusage. Auch, weil Liberale und auch Unionspolitiker im Wahlkampf noch hinterfragt hatten, warum Deutschland denn »fünf Jahre früher« als die EU klimaneutral werden müsse. Diese Diskussion ist vom Tisch. Das 2045er-Ziel ist weiterhin das Fundament für jährliche CO2-Einsparungen, der Gradmesser aller Klimamaßnahmen und verfassungsrechtlicher Entscheidungen.
Auch, dass Windanlagen »hässlich« sind und man sie irgendwann wieder abbauen müsse, ist nun schlicht die Privatmeinung des Kanzlers in spe. Im Koalitionsvertrag jedenfalls steht, man wolle weiterhin einen »entschlossenen Ausbau Erneuerbarer Energien« und dafür »alle Potenziale der Erneuerbaren Energien« nutzen (mehr zu den klimapolitischen Punkten des Vertrages lesen Sie hier in der SPIEGEL-Analyse ).
Klimageld wo bist du?
Ein Klimageld wird allerdings nicht explizit erwähnt. Dabei wird diese Klimaerstattung für alle Bürgerinnen und Bürger etwa vom Klimaexpertenrat der Bundesregierung oder dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung empfohlen. Finanziert werden sollte sie aus den staatlichen Einnahmen der CO2-Bepreisung. Die Idee dahinter war stets, einkommensschwache Haushalte zu unterstützen und jene Menschen zu bevorteilen, die besonders wenig CO₂ produzieren. Sie würden von der jährlichen Überweisung besonders profitieren – und so stiege der Anreiz für klimafreundliches Verhalten.
Im Koalitionsvertrag heißt es nun zwar, »die CO2-Einnahmen geben wir an die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zurück«. Mit »zurückgeben« meint die neue Regierung sehr wahrscheinlich aber etwas anderes als das Klimageld für jedermann. Stattdessen sollen die Bürger etwa durch einen niedrigeren Strompreis entlastet werden. Das wiederum setzt weniger Anreize, sich anders zu verhalten.
Erfreulich ist die Passage, wonach die Regierung sozial schwachen Bürgerinnen und Bürgern »unbürokratische Entlastungen« zukommen lassen will, »damit niemand überfordert wird«. In den nächsten Jahren könnten gerade Kraftstoffe wie Heizöl, Diesel und Benzin teurer werden. Ärmere Haushalte dürften diese Preiserhöhungen stark treffen, sie können sich einen Umstieg auf klimafreundliche Alternativen oft nicht leisten.
Auch wenn Maßnahmen nicht komplett zurückgedreht werden, gibt es umgekehrt kaum Stellen im Koalitionsvertrag, die explizit auf mehr Ambition im Klimaschutz schließen lassen. Die bräuchte es aber dringend, um die europäischen Klimaziele und sehr wahrscheinlich auch die deutschen Ziele nicht zu verfehlen. Zur Erinnerung: Die deutschen Treibhausgasemissionen müssen um rund 200 Millionen Tonnen in nicht mal mehr sechs Jahren sinken. Im vergangenen Jahr schrumpfte der CO2-Ausstoß um rund 23 Millionen Tonnen. (Dazu lesen Sie hier die Analyse der UBA-Zahlen für 2024 .)
Wasch mich, aber mach mich nicht nass
Gleichzeitig öffnet der Koalitionsvertrag Türen für Rückschritte. Bestes Beispiel ist das sogenannte Heizungsgesetz oder Gebäudeenergiegesetz (GEG), das unter der Ampel 2023 reformiert wurde. Es sieht schärfere Regeln für den Einbau von neuen Heizungen vor, mit denen CO2-intensive Öl- und Gasheizungen schrittweise durch klimafreundliche Lösungen ersetzt werden.
Die Union lobbyierte von Anfang an gegen das Gesetz, weil es fälschlicherweise mit dem Verbot bestimmter Heizungsarten gleichgesetzt wurde. Ihr Wahlkampfversprechen, das Gesetz abzuschaffen, steht nun im Koalitionsvertrag auf Seite 24. Schon einen Satz später steht da, dass »die Sanierungs- und Heizungsförderung« fortgesetzt werden soll. Die neue Regierung will ein neues Gesetz erarbeiten, bei dem etwa »Technologieoffenheit« und »Bezahlbarkeit« hergestellt werden. Beides erfüllt allerdings auch das alte Gesetz, da es keine Heizungsart ausschließt, die klimafreundlich ist. Selbst Wasserstoffheizungen können eingebaut werden. Zudem erstattet der Staat bereits jetzt bis zu 70 Prozent der Kosten.
Wozu das GEG also abschaffen?
Eine Neufassung birgt die Gefahr, dass die Regelung abermals verwässert wird. Selbst wenn Union und SPD sogar die Förderung für Wärmepumpen und Pelletheizungen beibehalten, könnte die Regel entfallen, dass jede neu eingebaute Heizung mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Seit 2024 gilt das für Neubauten, bei älteren Gebäuden tritt die Klimaschutzvorgabe schrittweise in Kraft. Fällt das weg, könnten Hausbauer und Wohnungsbesitzer künftig in Neubauten weiterhin Gasheizungen verbauen – eine schwerwiegende Entscheidung fürs Klima, aber auch für den eigenen Geldbeutel, da Erdgas absehbar teuer wird. Den Wählerinnen und Wählern im Jahr 2025 vorzugaukeln, dass sie nichts ändern müssen, wenn in 20 Jahren angeblich die gesamte Republik klimaneutral sein soll, ist unredlich.
An vielen Stellen merkt man dem Koalitionsvertrag diese »Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-nass«-Mentalität an. Union und SPD bekennen sich zu den Klimazielen, möchten aber strukturelle Reformen am liebsten umgehen. Sie wollen modern wirken, aber so wenig wie möglich verändern. Damit gerät Deutschland in der Klimapolitik zwangsläufig ins Hintertreffen.
Jede Gasheizung und jedes Dieselauto, das Menschen sich jetzt noch zulegen, werden in ein paar Jahren zum Problem. Das zögerliche Vorgehen kann nur zwei Gründe haben: Entweder die wahrscheinlich neue Koalition glaubt ohnehin nicht an die Klimaneutralität bis 2045, oder sie hofft auf technologische Wunderwaffen, die plötzlich die Welt vom CO2-Problem erlösen. Die Union wünscht sich etwa den ersten Fusionsreaktor der Welt in Deutschland, das steht auch im Koalitionsvertrag. Technisch ist daran in den kommenden Jahren kaum zu denken.
Beide Haltungen sind fatal. Zu hoffen bleibt, dass sich trotz allem eine klimapolitische Vernunft in der neuen Regierung einstellt. Potenzial dafür gibt es, auch im Koalitionsvertrag.
Wenn Sie mögen, informieren wir Sie einmal in der Woche über das Wichtigste zur Klimakrise – Storys, Forschungsergebnisse und die neuesten Entwicklungen zum größten Thema unserer Zeit. Zum Newsletter-Abo kommen Sie hier.
Die Themen der Woche
Wirtschaftsministerium als politischer Spielball: Weg mit dem Klimaschutz
Wohl kein Bundesministerium wurde so oft umgekrempelt wie das Wirtschaftsressort, und kaum ein Ressortchef wurde im Amt glücklich. Jetzt übernimmt die CDU. Und baut schon wieder um.Trockenheit in Deutschland: Wir handeln immer erst, wenn es zu spät ist
Die Dürre ist zurück, Deutschland hat ein Wasserproblem. Davor warnen Forscher seit Jahren. Vorsorge wird aber kleingeschrieben, auch im neuen Koalitionsvertrag. Das Thema kommt darin nur an zwei Stellen vor.Zeremonie im Weißen Haus: Trump will Kohleproduktion in den USA ankurbeln
Kohle gilt als umweltschädlichste Energiequelle. Donald Trump setzt dennoch auf ein Revival des Auslaufmodells und erzählt erneut Unwahrheiten über Deutschland.Dürre in Deutschland: Warum ist der Bodensee so leer?
Der Wasserstand am Bodensee ist außergewöhnlich niedrig, Dürre macht auch anderen Orten zu schaffen. Wissenschaftlerin Dörthe Tetzlaff erklärt, wie groß das Problem ist und was nun helfen würde.Milliardenschäden: Fliegende Feuermelder sollen Brandkatastrophen verhindern
Waldbrände vernichten jedes Jahr Häuser und Ortschaften, sie können Menschenleben kosten. Auch in Deutschland steigt das Risiko. Firmen versuchen, das Problem mit neuen Satellitennetzwerken einzudämmen.Bei Schaffhausen: Am Rheinfall fließt nur die Hälfte des für April üblichen Wassers
Der Rheinfall ist für seine tosenden Wassermassen bekannt. Doch nun ergibt sich dort ein anderes Bild: mit Moos bewachsene Felsen. Dafür gibt es Gründe.
Bleiben Sie zuversichtlich!
Ihre Susanne Götze
Redakteurin Wissenschaft
Klimaschutz in der neuen schwarz-roten Koalition: Viel wird davon abhängen, wer wo Minister oder Ministerin wird
Foto: Mike Schmidt / IMAGOWindpark in Heidekrug: Auch die neue Regierung will erneuerbare Energien fördern
Foto: Sean Gallup / Getty Images