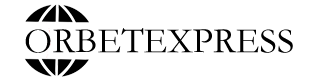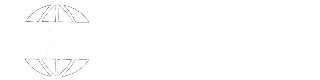1. Erzwungene Politpause
Würde in Frankreich jetzt gewählt werden, käme die rechtspopulistische Politikerin Marine Le Pen nach Umfragen auf mindestens 35 Prozent der Stimmen. Einen ersten Wahlgang würde sie klar für sich entscheiden. Doch die nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich sind erst 2027. Dass Le Pen antreten kann, scheint seit heute quasi ausgeschlossen. Stattdessen dürfte sie die Wahl mit elektronischen Fußfesseln als Zaungast beobachten.
Ein Gericht in Paris verurteilte Le Pen zu einer vierjährigen Haftstrafe, von denen zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden und die übrigen beiden durch das Tragen einer elektronischen Fußfessel abgebüßt werden können. Sie soll außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro zahlen und darf in den kommenden fünf Jahren für kein Amt kandidieren. Le Pen wurde schuldig gesprochen, im Zentrum eines organisierten Betrugs- und Veruntreuungsskandals zu stehen .
Der Vorwurf: Während ihrer Zeit als EU-Abgeordnete soll Le Pen rund vier Millionen Euro Steuergelder missbraucht haben. Zum Schein sei Personal für sie als EU-Abgeordnete angeheuert worden, das in Wahrheit aber für Le Pens Partei Front National (FN), später Rassemblement National (RN), gearbeitet haben soll. Neben ihr wurden 24 weitere Personen verurteilt. Meine Kollegin, Frankreich-Korrespondentin Britta Sandberg, schreibt, Le Pens natürlicher Nachfolger wäre der jetzige Parteichef des RN, Jordan Bardella. Der 29-Jährige gilt als Le Pens Zögling, doch er gilt als unerfahren.
Le Pens Anhänger und auch sie selbst versuchen, das Urteil natürlich nun umzudeuten. Man wolle sie politisch ausschalten, so der Vorwurf, sie selbst sprach vor der Verkündung von einem »politischen Todesurteil«, das über sie gefällt werden könnte. So, als wäre die Veruntreuung von vier Millionen Euro ein Kavaliersdelikt. Tatsächlich ist der heutige Tag ein Beleg dafür, wie unabhängig Gerichte in einem Rechtsstaat sein können. Solange er eben existiert. Unter Le Pen wäre das zumindest infrage gestellt.
Lesen Sie hier mehr: Der tiefe Fall einer Populistin
2. Katastrophe und Krieg in Myanmar
Drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,7 mit Epizentrum in Myanmar suchen Einsatzkräfte in den Trümmern weiter nach Überlebenden. In der besonders betroffenen Stadt Mandalay gelang es chinesischen Teams, rund 60 Stunden nach der Katastrophe drei Verschüttete lebend zu bergen, darunter ein fünfjähriges Kind.
Doch diese guten Nachrichten werden immer seltener. Staatsmedien beziffern die Toten auf mindestens 1700, es dürften eher mehr sein. Tausende Menschen wurden verletzt, viele werden noch vermisst. Die Infrastruktur ist schwer beschädigt: Häuser stürzten ein, Straßen und Brücken wurden zerstört, Krankenhäuser sind überfüllt, und es fehlt an medizinischen Hilfsmitteln. Strom- und Wasserversorgung sowie Kommunikationsnetze sind teils ausgefallen.
Die humanitäre Lage ist katastrophal, nicht zuletzt wegen des Bürgerkriegs. Viele Regionen sind schwer zugänglich, und die Militärjunta kontrolliert die Verteilung der Hilfen. Internationale Organisationen warnen vor Krankheitsausbrüchen und fordern dringend Unterstützung. Temperaturen bis zu 39 Grad und drohender Monsunregen erschweren die Situation zusätzlich. Trotz der Not setzt das Militär Luftangriffe fort, was die Krise weiter verschärft . Millionen Menschen sind auf Hilfe angewiesen, doch die politische Lage behindert effektive Maßnahmen.
Meine Kollegin Maria Stöhr und mein Kollege Georg Fahrion analysieren, dass Myanmars Diktator Min Aung Hlaing versucht, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Für das Land unüblich, hat er internationale Hilfe erbeten. So will er seine Machtbasis absichern. Daher dürfte es kein Zufall gewesen sein, dass einer der ersten Hilfsflüge ausgerechnet aus Putins Russland kam.
Lesen Sie hier mehr: Die Menschen graben nach Angehörigen, die Junta führt trotzdem Krieg
3. Wirtschaftsbosse in die Produktion
Die Koalition aus Union und SPD ist noch lange nicht gebildet, doch die Kritik an ihr hat schon ähnlich Fahrt aufgenommen wie zu schlechtesten Ampelzeiten. Vor allem Vertreter aus der Wirtschaft mäkeln.
Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall fordert die Spitzen von Schwarz-Rot auf, die Verhandlungen zu den Wirtschaftsthemen noch einmal neu zu starten. »Die Parteichefs müssen die Kurve kriegen und sämtliche Zwischenergebnisse streichen, die die Wirtschaftskrise noch verschärfen«, sagt der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Oliver Zander.
Auch für den Präsidenten des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Bertram Kawlath, gehen die bisherigen Gespräche »in die falsche Richtung«. Der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) mahnt, die Industrieproduktion in Deutschland sei seit 2019 um elf Prozent geschrumpft. In diesem Jahr erwarte er einen weiteren Rückgang um 0,5 Prozent. »Das wäre der vierte Rückgang in Folge.« Die Stimmung im Land sei »schlechter, als ich es je erlebt habe«.
Manchmal habe ich das Gefühl, die Wirtschaftsbosse glauben, Friedrich Merz oder Lars Klingbeil stünden selbst an den Fließbändern der Fabriken und müssten nur endlich mal einen Zahn zulegen. Dass die Wirtschaft womöglich selbst seit Jahrzehnten Innovationen verschlafen, verächtlich auf Wettbewerber geblickt und sich bräsig auf vergangenen Erfolgen ausgeruht hat, dieser Gedanke kommt in den Chefetagen offenbar keinem.
Niemand im Berliner Politikbetrieb wird eine Firma daran hindern, ein konkurrenzfähiges Produkt zu erfinden und zu verkaufen. Es reicht nicht, die Schuld für die eigene Unzulänglichkeit ständig in der Politik zu suchen.
Lesen Sie hier mehr: Industrie hält Pläne von Schwarz-Rot für falsch
Was heute sonst noch wichtig ist
Netanyahu bestimmt trotz Protesten neuen Geheimdienstchef: Die Entlassung von Israels Inlandsgeheimdienstchef Ronen Bar löste in Israel Massenproteste aus. Nun hat Premier Netanyahu einen Nachfolger benannt. Die Personalie soll in einem Ausschuss geprüft werden.
Mehrheit wünscht sich Tempolimit auf Autobahnen: Auf Autobahnen soll weniger gerast werden, das wünschen sich die meisten Autofahrer. Im Schnitt plädieren sie für maximal 133 Kilometer pro Stunde. Die Mehrheit für ein allgemeines Tempolimit ist kleiner geworden.
Eine ganz Große hört auf: 66 Länderspiele, Olympiasiegerin, Führungspersönlichkeit: Mit Almuth Schult tritt eine der prägenden Figuren des deutschen Fußballs der vergangenen Jahre zurück. Ihr Comeback nach zwei Schwangerschaften beeindruckte viele.
Dr. Oetker schrumpft Produkte und verteuert sie damit um bis zu 50 Prozent: Weniger Inhalt, gleicher Preis: Verbraucherschützer haben bei Dr. Oetker gleich eine ganze Serie an Produkten mit »Shrinkflation« ausgemacht. Sie kritisieren teils überzogene Preiserhöhungen, sehen aber auch Fortschritte.
Meine Lieblingsgeschichte heute:
Ich wohne im Südosten Hamburgs. Wenn ich nicht mit der S-Bahn fahre, sondern mit dem Auto, führt mich die Route oft über die Norderelbbrücke. Dort gilt seit Kurzem eine neue Verkehrsführung. Die sechs Fahrstreifen – je drei in Richtung Bremen und Lübeck – wurden verengt und mehr in die Mitte der Brücke verlegt. Die Spur für Lastwagen liegt jetzt direkt auf dem Tragwerk der Brücke und nicht mehr in den Problembereichen am Rand. Lastwagen dürfen in Richtung Lübeck nur die rechte Spur nutzen. Zudem müssen Lastwagen ein Mindestabstandsgebot von 50 Metern einhalten. Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert. Der Grund: Die Brücke ist marode. Damit ist sie eine von 19.000 Brücken in Deutschland, die baufällig sind. Meine Kollegen Tobias Großekemper und Steffen Winter haben mal zusammengetragen, wie dringlich das Problem wirklich ist. Nach der Lektüre des Textes werde ich das Bauwerk wohl meiden und künftig lieber Umwege fahren.
Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Willkommen im Katastrophenfilm
Was heute weniger wichtig ist
James Blond? Ist der nächste 007-Agent eine Agentin? Diese Idee wird immer wieder diskutiert. Schauspielerin Helen Mirren, 79, hält nichts davon – weil sie die Filmserie nicht leiden kann. Sie sei zwar ein großer Fan des ehemaligen Bond-Darstellers Pierce Brosnan, aber die Figur des Agenten sei ihr immer unsympathisch gewesen. »Ich habe James Bond nie gemocht. Ich mochte nie, wie Frauen in James Bond waren.«
Mini-Hohl
Aus der »Saarbrücker Zeitung«: »Fast 20 Jahre, nachdem das Trio abgetaucht war, spürte das Bundeskriminalamt den inzwischen toten Verdächtigen in Venezuela auf. Die Polizei nahm ihn fest, er kam in Südamerika in Haft.«
Hier finden Sie den ganzen Hohl.
Cartoon des Tages
Und heute Abend?
Sollten Sie SPIEGEL-Abonnentin oder -Abonnent sein, könnten Sie an unserem Format »Deep Dive« teilnehmen. Das Thema: Smarte Geldanlage – so schließe ich die Rentenlücke. Ob Sparbuch, ETF oder Goldbarren: Es gibt viele Möglichkeiten der finanziellen Vorsorge. Expertin Sandra Klug und SPIEGEL-Redakteur Florian Diekmann beantworten Ihre Fragen zum Thema. Live heute Abend, 31. März, um 20 Uhr. Hier können Sie sich anmelden.
Einen schönen Abend. Herzlich
Ihr
Janko Tietz, Ressortleiter Nachrichten
Le Pen bei Ankunft vor Gericht: Kopfschüttelnd hörte sie den Erklärungen der Richterin zu
Foto: Lionel Préau / Riva Press / laifMandalay, Myanmar: Rettungskräfte versuchen Tag und Nacht, unter den Trümmern Überlebende zu finden
Foto: REUTERSBertram Kawlath auf der Hannover Messe: »Das wäre der vierte Rückgang in Folge«
Foto: Ronny Hartmann / AFPEingestürzte Carolabrücke in Dresden: »Deutliche Mängel« bei der Infrastruktur in Deutschland
Foto: Robert Michael / dpa / picture allianceHelen Mirren
Foto: Henry Nicholls / AFPEntdecken Sie hier noch mehr Cartoons.
Klaus Stuttmann
Sandra Klug und Florian Diekmann
Foto: DER SPIEGEL