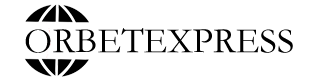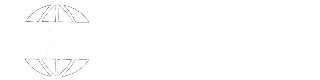Ist das nicht verrückt? Da zerbricht man sich den Kopf, wochenlang, monatelang, welcher der richtige Name für das eigene Kind ist. Man durchstöbert Listen, identifiziert Lieblingsbuchstaben und versucht, eine einzigartige Mischung von Individualität, Zeitgeist und Wohlklang zu erreichen, und dann kommt Jahre später so etwas dabei heraus:
Man steht in einer Garderobe und ruft in aller Öffentlichkeit: »Jacke anziehen, Mausi!«
Mausi. Null Individualität, null Wohlklang. Nur Liebe.
Dabei wäre der Taufname so hübsch. Hübscher auch als »Fiepi«, der Spitzname, der noch aus der Brutkastenzeit stammt. War doch ein kaum vernehmbares »Fiep« der erste Laut, den unser Mädchen mit seinen 745 Gramm Geburtsgewicht irgendwann von sich gab. Bis heute nennen wir Eltern unser Kind so, wenn wir zu zweit sind. Zärtlichkeit schlägt Schönheit.
Zwischendurch aber kommen mir andere Kosenamen flüssig über die Lippen, vielleicht sogar zu flüssig. Denn während meine Tochter mit Downsyndrom in der Garderobe nur ein genervtes »Jaaaa!« von sich gab und sich nicht rührte, wiederholte ein anderes Mädchen meine Worte: »Los, Jacke anziehen, Mausi!« Und ich überlegte plötzlich, wann wohl die Phase kommt, in der ich meiner Tochter peinlich bin. Mit meinen Kosenamen und überhaupt.
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir, im Vergleich zu anderen Familien, phasenverschoben leben. Bis bestimmte Wegmarken erreicht sind – laufen lernen, sprechen lernen, lesen lernen – benötigt unsere Tochter etliche Anläufe und Wiederholungen. Bei uns ist Entwicklung kein Steilflug, sondern ein gemächliches Wandern den Hügel hinauf. Und oben wird erst einmal ein Wurstbrot gegessen. Oder zwei.
Das Schöne sei, sagte eine Freundin einmal, die einen Jungen mit Downsyndrom hat, dass »unsere« Kinder länger Kind seien. Ihre Kindheit so richtig ausleben würden. Das stimmt auf jeden Fall. Doch es gibt auch eine schmerzvolle Seite dieser Phasenverschobenheit. Wenn etwa eine Lehrerin mir erzählt, wie zwei Kinder mit Downsyndrom an die weiterführende Schule kamen und sich im Unterricht ein Spiel aussuchen durften. Sie wünschten sich Plumpsack – und wurden zum Gespött der Klasse.
Wenn ich Geschichten wie diese höre, zieht sich mir das Herz zusammen. Und ich will nichts mehr, als unsere Tochter stark machen für alles, was kommen kann. Auch mit Kosenamen, die wir manchmal kichernd aufzählen, wenn wir allein sind. Mit diesem Wunsch geht es mir wohl so wie allen Eltern. Denn die besagte Szene in der Garderobe endete so:
»Wie sagt denn deine Mama zu dir?«, fragte ich das Kind, das meine Tochter grinsend »Mausi« genannt hatte. Das Mädchen hörte auf, zwischen den Jacken herumzuwirbeln, schaute mich an und antwortete mit großem Ernst: »Hasi«.
(Weiterführende Kosenamen-Literatur finden Sie übrigens hier .)
Meine Lesetipps
Wie viel Unterstützung benötigt unser Kind? Wie viel Unterstützung können wir als Eltern geben, ohne uns selbst aufzugeben? Und wie lange soll sie währen? Wann ist auch Loslassen Unterstützung, und wann wäre das Versagen von Unterstützung unverantwortlich? Das sind Fragen, die sich in manchen Familien in besonderer Schärfe und Dringlichkeit stellen. Auch ich kenne sie gut.
Ich möchte Ihnen deshalb diese Woche ein ganzes Textpaket von meiner Kollegin Heike Le Ker ans Herz legen. »Wie krank sind unsere Kinder wirklich? « heißt ihr umfassender Report. Dabei geht es zum einen um die vielfältigen Diagnosen – von Angststörungen über Depressionen, selbstverletzendem Verhalten, ADHS bis zu Essstörungen. Heike berichtet aber auch von den langen Wartezeiten auf Therapieplätze, vom Personalmangel bei Schulbegleitern und anderen strukturellen Problemen. Und sie zeigt Lösungsansätze!
Heike hat zudem eine Selbsthilfegruppe von Eltern besucht, deren Kinder psychisch erkrankt sind. Die Sätze der Mütter, die sie protokolliert hat , haben mich in ihrer Eindringlichkeit sehr berührt:
»Ich hatte immer wieder den Eindruck, dass mir die Schuld an der Krankheit meines Sohnes gegeben wurde.« Oder: »Ich liebe meine beiden Töchter über alles. Aber die extreme Nähe raubt mir manchmal die Luft zum Atmen.« Oder: »Wenn wir uns nicht kümmern, tut es kein anderer!«
Mit der Kinderärztin Désirée Ratay hat Heike darüber gesprochen, wie sich der Stress der Eltern auf die psychische Gesundheit ihrer Kinder auswirken kann. Ratay sagt: »Wenn Eltern dauerhaft angespannt sind, leben sie ihren Kindern vor, dass das die Normalität ist. Die Kinder lernen nicht, wie sie Stress erkennen, damit umgehen und ihn reduzieren können. Damit das Gehirn von Kindern gesund reifen kann, brauchen sie aber eine liebevolle und aufmerksame Beziehung zu ihren Eltern.«
Sie betont, wie wichtig es ist, Kindern das Konzept der Selbstfürsorge zu vermitteln. Und das fängt bei Kleinigkeiten an: »dass sie ihr Zimmer schön gestalten oder sich eine Lichterkette zum Einschlafen anschalten. Eltern können das in Worte fassen und sagen: ›Jetzt hast du es dir richtig gemütlich gemacht und dir etwas Gutes getan.‹«
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie das Verhalten Ihres Kindes einschätzen sollen, empfehle ich Ihnen Heikes Gespräch mit der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Cornelia Metge. Sie nennt Kriterien und Alarmzeichen, auf die Eltern achten sollten , zum Beispiel: Wie lange dauern die Probleme schon an? Klagen die Kinder häufig über Kopf- und Bauchschmerzen? Handelt es sich um altersgerechtes Verhalten oder nicht? Kann das Kind gut einschlafen? Verliert es rapide an Gewicht?
Unsere Tochter mit Downsyndrom kommt mir zum Glück recht resilient vor. Auch wenn ich mir manchmal wünsche, sie könnte mir mehr von ihrem Innenleben erzählen. Denn bisher bleibt ihr sprachliches Ausdrucksvermögen hinter ihren geistigen Fähigkeiten zurück. Und so muss auch ich aufpassen, dass ich sie nicht unterschätze, so wie es immer wieder passiert. Einfach, weil sie jünger aussieht und jünger wirkt und wir alle schnell – zu schnell – von der Sprache auf den Intellekt schließen. Oft merke ich erst hinterher, was sie alles verstanden hat, worüber sie sich alles Gedanken macht. Ich werde also künftig darauf achten, dass ich nicht wieder in die »Mausi«-Falle tappe. Und sie vor anderen kleiner wirken lasse, als sie ist.
Welche Kosenamen benutzen Sie in Ihrer Familie? Wie kam es dazu? Und sind Sie vielleicht noch heute heimlich ein Nagetierchen, obwohl Sie längst selbst Kinder haben? Schreiben Sie mir gern Ihre kleinen Geschichten der Zärtlichkeit an familiennewsletter@.de
Das jüngste Gericht
Unsere Tochter ist ein richtiges Wursttheken-Kind. Und ein Brezeltheken-Kind, das selbst von unserer Bäckerin mit Kosenamen bedacht wird: »Hier, mein Schatz!« Deshalb ist es nur folgerichtig, dass in unserem Bücherregal ein besonderes Kochbuch steht. Es heißt »#46pluskocht – voll lecker« und zeigt all die Köstlichkeiten, die Kinder und Jugendliche mit Trisomie 21 gemeinsam mit Profiköchinnen und -köchen zubereitet haben. Wer die Fotos betrachtet, wünscht sich, dabei gewesen zu sein beim Schnitzelpanieren und Bratkartoffelhochwurf. Und versteht: Leben ist essen, und essen ist leben. Weshalb ich mich auch für prachtvolle Sandwichs begeistere, wie dieses Muffuletta-Rezept von unserer Kochkolumnistin Verena Lugert. Eine wahre Kunstform zum Verschlingen!
Mein Moment
Vergangene Woche hat mein Kollege Malte Müller-Michaelis über einen Rollentausch von Frauen und Männern nachgedacht, woraufhin unsere Leserin Miriam K. von ihrem Familienmodell erzählte: »Mein Mann und ich haben zwei Kinder und bei beiden jeweils sieben Monate Elternzeit genommen. Als Mama habe ich die ersten sieben Monate gestillt, danach hat mein Mann übernommen und ich bin wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Diese Erfahrung des Rollentauschs fand ich unglaublich bereichernd.«
Zwar sei es ihr anfangs schwergefallen, die Verantwortung komplett abzugeben, gibt sie zu, aber letztlich hätten alle Seiten profitiert. »Die Kinder hatten dadurch Erfahrungen …, die sie mit mir allein nie gehabt hätten, sei es der Kiwibrei oder Krabbeln im Wald. Als ich wieder arbeiten gegangen bin, hatte ich selbstbestimmte und erfüllende Zeiten auf der Arbeit, und wenn ich nach Hause kam, erwartete mich ein glückliches Kind, das sich riesig freute, die Mama wiederzusehen und gleichzeitig einen tollen Tag mit seinem Papa erlebt hatte. Mein Mann hat nicht nur den Haushalt geschmissen, sich um Essen und Kind gekümmert, sondern dabei auch das aufholen können, was ich als Heimvorteil in den ersten Monaten mit dem Kind erlebt habe. Er hat intuitiv Wissen und Erfahrungen aufgesaugt, die unser Familienleben unglaublich entspannt haben, da nun jeder beide Seiten kennt.«
Und so wirkt Miriam K. sehr zufrieden mit ihrem Familienalltag heute: »Nach unseren Elternzeiten sind wir beide zu einem 50/50 Modell gewechselt (...) Obwohl wir es oft als anstrengend empfinden, weil es viel mehr Kommunikation und Koordinationsarbeit erfordert und leider einfach noch nicht der Standard in der Gesellschaft ist, ...sind wir sehr glücklich darüber, wie wir uns aufeinander verlassen können und beide Erfüllung im Beruf und zu Hause erleben.«
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit Ihrer Familie – und mit allen Hasis und Mausis, die zu Ihnen gehören!
Herzlich,
Ihre Sandra Schulz
Nicht originell, aber liebevoll: Wenn kleine Kinder wie kleine Tiere heißen (Symbolbild)
Foto: Westend61 / Getty ImagesKinderärztin Ratay: »Ein Kind lernt dann: Ich nerve. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht richtig. Ich störe meine Eltern«
Foto:Florian Bayer / DER SPIEGEL
Therapeutin Metge: »Viele Eltern haben ein Gespür dafür, wenn etwas nicht mehr stimmt«
Foto:Florian Bayer / DER SPIEGEL