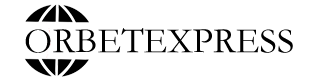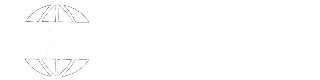Der Peruaner Saúl Luciano Lliuya reist nächste Woche zum dritten Mal nach Deutschland. Der Kleinbauer lebt eigentlich in der auf 3000 Meter Höhe gelegenen Stadt Huarez in den Anden, betreibt einen Bauernhof mit Hühnern und Schafen, er baut auch Mais und Quinoa an. Das klingt idyllisch, aber sein Zuhause ist bedroht: Oberhalb der Stadt liegt der Gletschersee Palcacocha, der die gesamte Umgebung mit rund 50.000 Einwohnern zu überschwemmen droht.
Sehr wahrscheinlich wäre Lliuya nie nach Deutschland gekommen, hätte er nicht vor zehn Jahren den deutschen Energieriesen und Kohlekonzern RWE verklagt. Das erste Mal besuchte der Bauer das Ruhrgebiet 2015, damals forderte Lliuya von RWE 17.000 Euro Schadensersatz. Der Grund: Die Gletscher in den Anden schmelzen und haben den Pegel des Sees bereits »immer wieder gefährlich ansteigen« lassen. RWE ist einer der größten Treibhausgasemittenten Europas und laut Anklageschrift für 0,47 Prozent des weltweiten CO₂-Ausstoßes verantwortlich. Seinem Anteil nach solle sich der Konzern entsprechend an den 3,5 Millionen Euro Kosten für die künstliche Absenkung des Wasserpegels des Palcacocha-Sees beteiligen. Nur so könne die Stadt gerettet werden.
»Als ich im Herbst 2015 diese Klage in Deutschland eingereicht habe, hätte ich nicht gedacht, dass alles so lange dauern würde«, sagt Lliuya der Nichtregierungsorganisation Germanwatch, die ihn bei der Klage unterstützt. Mittlerweile ist er eine Gallionsfigur der Bewegung für Klimagerechtigkeit, die westliche Konzerne für die Folgen des menschengemachten Klimawandels im Globalen Süden verantwortlich machen will.
Beweise sammeln am schmelzenden Gletscher
Am Montag beginnt in Hamm vor dem Oberlandesgericht nun die mündliche Verhandlung. Es ist zuständig, weil RWE seinen Sitz in Essen hat. Dort geht es noch lange nicht um eine finale Entscheidung, sondern erst mal um die Beweisaufnahme. Schon das sehen der Kläger und seine Unterstützer als Erfolg.
Ab Montag geht es zunächst darum, ob tatsächlich ein hinreichendes Flutrisiko für Lliuyas Haus besteht. Dazu werden Sachverständige befragt, die vor Ort die Risiken untersucht haben. Erst im zweiten Schritt soll dann die Frage geklärt werden, inwieweit der Klimawandel und die RWE-Emissionen mitverantwortlich für eine potenzielle Überflutung sind.
Erstmals beschäftigt sich ein Gericht somit ernsthaft mit der Frage der Schuld an der Klimakrise und daraus folgenden Konsequenzen. Zwar wurden Unternehmen und Regierungen bereits gerichtlich gezwungen, Klimaziele aufzustellen. Aber Geldstrafen aufgrund von verursachten Klimawandelfolgen gab es bisher nicht. Deshalb geht es bei dem Prozess auch weniger um den Schadenersatzbetrag von 17.000 Euro, sondern um ein Grundsatzurteil.
RWE erklärt, dass sich das Unternehmen stets an staatliche CO₂-Vorgaben gehalten habe. Zudem gibt es laut einem Unternehmenssprecher »keine Rechtsgrundlage für die Haftung einzelner Emittenten für global wirkende Vorgänge wie den Klimawandel«.
Das juristische Vorspiel der anstehenden Verhandlung war lang, mehrmals scheiterte die Klage fast. So hatte das Landgericht Essen die Klage Ende 2016 abgeschmettert. Ein einzelnes Unternehmen könne nicht für den Klimawandel verantwortlich gemacht werden, hieß es damals. Doch der Kleinbauer ging in Berufung, ein Jahr später ordnete das Oberlandesgericht Hamm die nun beginnende Beweisaufnahme an, da die Klimaklage des Bauern schlüssig begründet sei. Einen Antrag von RWE gegen die Beweisaufnahme wies das OLG im Februar 2018 zurück. Vier Jahre später reiste eine neunköpfige Delegation auf Anordnung des OLG Hamm in die peruanischen Berge, um die Gefahrenlage durch den Gletschersee zu begutachten. Diese Erkenntnisse nutzt das Gericht dann für seine weitere Entscheidung, ob das Risiko rechtlich ausreicht, um RWE haftbar zu machen.
Gletscherseen: Eine Gefahr für Millionen Bergbewohner weltweit
Die Verhandlung nächste Woche dürfte abgesehen von RWE noch einen Effekt haben: In einem deutschen Gericht wird erstmals ausführlich und wissenschaftlich fundiert über Gletscherseen gesprochen. Der Fall von Lliuya zeigt, welche dramatischen Folgen die Klimakrise für Bewohner von Hochgebirgen hat – nicht nur in Peru. Überlaufende Gletscherseen bedrohen weltweit rund 15 Millionen Menschen, berichtet etwa ein Forschungsteam im Fachjournal »Nature Communications« bereits im Jahr 2023.
Am größten ist das Risiko für die Bevölkerung in asiatischen Hochgebirgen und in den Anden: Schmelzen Gletscher im Zuge des globalen Temperaturanstiegs, kann sich das ablaufende Schmelzwasser zu neuen Seen sammeln oder bestehende immens vergrößern. Besonders dramatisch verläuft das, wenn ein natürlicher Damm an einem solchen Gewässer bricht. Talabwärts kommt es dann ohne jegliche Vorwarnung zu Überschwemmungen.
In der Vergangenheit hätten solche Ausbrüche bereits zu vielen Todesfällen und Schäden an Infrastruktur und landwirtschaftlichen Flächen geführt. Seit 1990 hätten laut den Forschenden Zahl, Fläche und Volumen der Gletscherseen weltweit zugenommen, zudem sei die Bevölkerung in den talwärts liegenden Gebieten rapide gewachsen, so die Studie. Allein in der Cordillera Blanca in den nördlichen Anden Perus seien in den vergangenen 70 Jahren mehrere Tausend Menschen von Fluten aus Gletscherseen getötet worden, berichtet das Fachteam. Talabwärts des in der Region liegenden Palcacocha-Sees liegt übrigens Lliuyas Heimatstadt Huaraz.
Klimabedingte Risiken in Gebirgsgegenden gibt es nicht nur in Südamerika. Auch in den Alpen wachsen die Gefahren. Dort gibt es etwa unterirdische Gletscherseen , in denen sich Schmelzwasser staut und die schließlich kontrolliert entleert werden müssen. Doch auch Steinschläge nehmen zu, weil Gletscher zurückgehen, der Permafrost auftaut und Feuchtigkeit im Boden Steine und Felsbrocken löst. Sogenannte Murgänge entstehen, wenn durch starken Regen Geröll, Schutt und Erdreich an einem steilen Hang abrutschen. Das kann ganze Siedlungen verschütten. Doch in Europa gibt es weitaus bessere Frühwarnsysteme als etwa in Peru. Die Anwohner können sich zudem besser schützen.
Der Fall des Peruaners Saúl Luciano Lliuya könnte also auch dazu beitragen, dass mehr über die Folgen der Klimakrise gesprochen wird – auch hierzulande.
Wenn Sie mögen, informieren wir Sie einmal in der Woche über das Wichtigste zur Klimakrise – Storys, Forschungsergebnisse und die neuesten Entwicklungen zum größten Thema unserer Zeit. Zum Newsletter-Abo kommen Sie hier.
Die Themen der Woche
Daten des Umweltbundesamts: Deutschlands CO₂-Emissionen sinken – aber nicht schnell genug
Der Ausstoß von Klimagasen ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen – dank mehr Ökostrom und weniger Kohlekraft. Ohne einen Anstieg bei Elektroautos und Wärmepumpen aber sind die Klimaziele für 2030 in Gefahr.Energiewende-Budget im Sondervermögen: Wie viel Geld braucht Deutschland für die Klimatransformation?
Der Klimaschutz spielt beim geplanten Sondervermögen bisher nur eine Nebenrolle. Dabei müsste dort ähnlich aufgestockt werden wie bei der Verteidigung, sagen Forscher. Längerfristig würde sich das finanziell sogar auszahlen.Gesundheitsschädlicher Feinstaub: Nur auf einem Kontinent werden WHO-Luftgrenzwerte erfüllt
Orte mit einer geringen Feinstaubbelastung sind rar. Eine Auswertung zeigt nun: Nur sieben Länder erfüllten 2024 den von der WHO empfohlenen Grenzwert. Doch es gibt auch gute Nachrichten.Klimawandel im Globalen Norden: Frankreich bereitet sich auf Erderwärmung um vier Grad vor
Die französische Umweltministerin stimmt ihr Land auf die »tragische Realität« des Klimawandels ein: Mehr als 50 Maßnahmen sollen helfen, etwa die Landwirtschaft zu schützen. Umweltorganisationen üben Kritik.Biodiversitätskrise: »Wir Menschen sind eine bedrohte Spezies, auch wenn wir es noch nicht wahrhaben wollen«
Jonah Ratsimbazafy hat eine Mission: Der Forscher will die mehr als 100 auf Madagaskar lebenden Lemurenarten retten. Denn es droht ein massenhaftes Aussterben, das das Ökosystem und damit auch die Menschheit gefährden könnte.
Bleiben Sie zuversichtlich!
Ihre Susanne Götze
Redakteurin Wissenschaft
Ist mittlerweile in der deutschen Klimaszene eine Berühmtheit: Der Peruaner Saúl Luciano Lliuya
Foto: Luka Gonzales / AFPGletschersee in Österreich: Auch in den Alpen können schmelzende Gletscher zu Überschwemmungen führen
Foto: Eibner Europa / EXPA / Groder / imago imagesSaúl Luciano Lliuya zeigt auf den schmelzenden Gletscher: RWE soll seine Mitschuld am Klimawandel anerkennen
Foto: Dan Collyns / Thomson Reuters Foundation